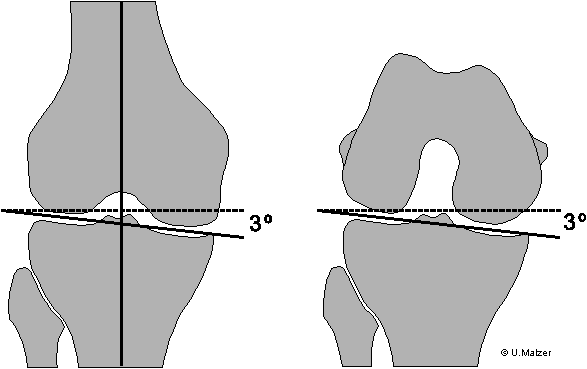
veröffentlicht in: Orthopädische Praxis, Heft 3, März 1998, 34. Jahrgang, Seite 141 - 146
Für den erfolgreichen Kniegelenksersatz ist eine anatomiegerechte Ausrichtung der Komponenten eine wichtige Voraussetzung. Die Resektionen sollten sich an anatomischen Landmarken, wie der Epicondylenlinie, der a/p - Achse und der tuberositas tibiae orientieren.
Wir beschreiben einige wichtige anatomische Eigenschaften des Kniegelenkes und ihre Bedeutung für die Implantationstechnik.
Heutige Kniegelenksimplantate haben einen hohen Entwicklungsstand und die klinische Erfahrung hat gezeigt, daß die Lebensdauer einer modernen Knieendoprothese der einer Hüftendoprothese nicht nachstehen muß.
Neben dem Implantatdesign stellt eine präzise Implantationstechnik die wichtigste Voraussetzung für den erfolgreichen Gelenkersatz dar. Als Ziele des Gelenkersatzes sind neben der Restauaurierung einer natürlichen Beinachse eine ausgewogene Weichteilbalance sowie eine zentrierte Patellaführung anzustreben.
Es existieren zahlreiche Hinweise in der Literatur, daß die meisten Fälle von Implantatversagen, nämlich Patellakomplikationen sowie der vorzeitige Verschleiß des Polyäthyleninlays auf Implantationsfehler zurückzuführen sind.
Aus diesem Grunde scheint es sinnvoll, sich genauer mit den anatomischen und technischen Voraussetzungen für eine korrekte Komponentenausrichtung zu beschäftigen.
Für das Verständnis der korrekten Implantatpositionierung sind einige anatomische Details von Bedeutung:
Bezogen auf die Horizontalebene weist die Kniegelenksebene eine Varusneigung von etwa 3 Grad auf, d.h. die tibiale Gelenklfläche ist um diesen Betrag nach medial geneigt (6,9). Femurseitig entspricht dieser Neigung eine entsprechende Prominenz des medialen Condylus nach distal (Abb.1).
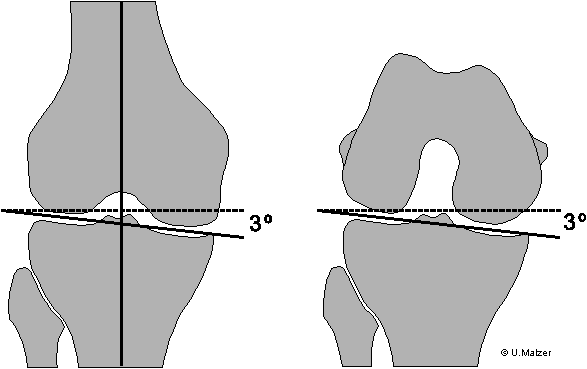 |
| Abb.1: Verlauf der Kniegelenksebene in Frontalansicht. |
In Beugestellung des Gelenkes resultiert aus der Neigung der Gelenklinie eine Innenotation der posterioren Condylenlinie von ca. 4 Grad, bezogen auf die Epicondylenachse (sog. ‘condylar twist’ (10)).
Nimmt man die Epicondylenachse als Referenz, so liegt die trochlea femoris zentral über dem höchsten Punkt der fossa intercondylaris; bezogen auf die posteriore Condylenlinie weist sie jedoch einen Lateralversatz um etwa 3-5 mm auf (Abb.2) (13).
Bei der posterioren Neigung des Tibiaplateaus (sog.‘slope’) finden sich relativ große individuelle Schwankungen, als mittlerer Wert wird in der Literatur ein Winkel von etwa 7 Grad angegeben (Abb.3) (6,12). Auch der Q-Winkel (Abb.3) weist individuelle Schwankungen auf, in der Literatur wird ein mittlerer Wert von etwa 15 Grad angegeben (1); bei Frauen findet sich zumeist ein etwas höherer Wert (Abb.3)
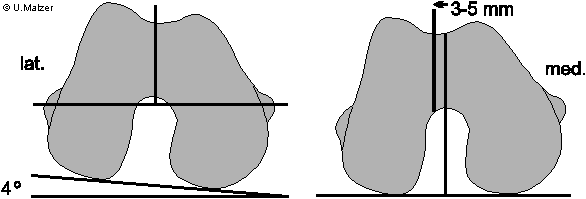 |
| Abb.2: Projektion der Patellagleitrinne; links : bezogen auf die Epicondylenlinie, rechts : bezogen auf die dorsale Condylenlinie |
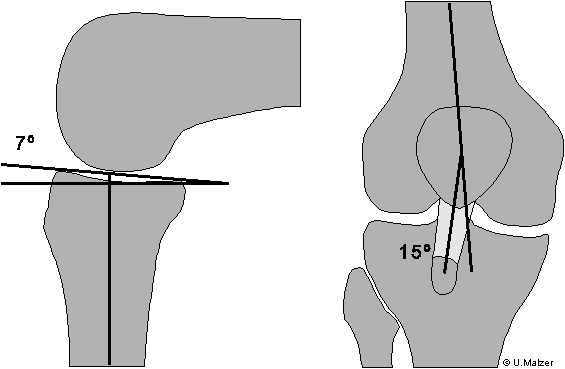 |
| Abb.3: Links : posteriore Neigung des Tibiaplateaus. Rechts : Q-Winkel (=Quadricepswinkel). Der Winkel wird durch die Verbindungslinien von spina iliaca anterior superior, Patellazentrum und Zentrum der tuberositas tibiae gebildet. |
Aus der Anatomie ergeben sich Konsequenzen für die Resektionen. Hier bestehen grundsätzlich zwei Optionen für das Anlegen der Sägeschnitte (7):
Bei der sogenannten ‘anatomischen’ Resektion werden entsprechend der Implantatdicke gleichgroße Knochenscheiben medial und lateral reseziert (Abb.4).
Die Resektionslinie folgt der anatomischen Neigung des Gelenkspaltes. Bezogen auf die mechanische Achse des Beines liegen die Schnitte also in etwa 3 Grad varus. Am Femur gilt dies sowohl in Beugung als auch in Streckung, d.h. es wird jeweils überall in gleicher Höhe reseziert.
Durch die identische Dicke der Resektate entsprechend der Implantatdicke entstehen parallele Resektionsspalte und es ist im Normalfall ein gut balanciertes Gelenk in Beugung und Streckung zu erwarten.
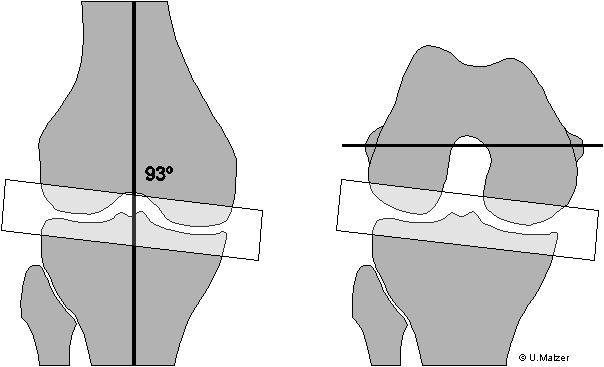 |
| Abb.4: ‘Anatomische Resektion’: Die Resektionslinien verlaufen parallel zur Kniegelenksebene. Die Resektate weisen identische Dicken auf. Der Resektionsspalt ist in Beugung und Streckung parallel und gleichweit. |
Im Gegensatz hierzu ist bei den meisten modernen Instrumentaren jedoch die sogenannte ‘Klassische’ Resektion (auch:‘Standardresektion’) vorgesehen (Abb.5,6). Hierbei werden der tibiale und der distal-femorale Schnitt senkrecht zur mechanischen Beinachse gelegt. Als Ergebnis ergibt sich im Normalfall eine relative Unterresektion an der medialen Tibia mit korrespondierender relativer Überresektion am medialen Femur. Die Resektionsdicken gleichen sich in Streckung aus, und es resultiert ein paralleler Resektionsspalt.
Betrachtet man den Gelenkspalt in Beugung, so zeigt sich, daß auch die dorsalen Femurschnitte asymmetrisch angelegt werden müssen, weil sich bei einer Resektion parallel zur dorsalen Condylenlinie ein trapezförmiger Resektionsspalt und damit eine relative Enge des medialen Gelenkspaltes in Beugung ergeben würde (Abb.5). Hier könnte eine wichtige Ursache für einen vorzeitigen Verschleiß des posteromedialen Polyäthyleninlays liegen.
Für eine korrekte, asymmetrische Resektion ist somit eine Rotationskorrektur erforderlich. Sie entspricht der anatomischen Gelenkneigung und beträgt im Normalfall etwa 3 Grad Außenrotation, bezogen auf die dorsale Condylenlinie (Abb.6).
Durch die Rotationskorrektur entsteht wieder eine relative mediale Über- und laterale Unterresektion der dorsalen Femurcondylen, welche die asymmetrische tibiale Resektion auch in Beugung kompensiert und somit einen parallelen Resektionsspalt ergibt.
Eine fehlerhafte dorsale Femurresektion mit zu wenig Außenrotationskorrektur erzeugt nicht nur einen relativ engen medialen Gelenkspalt in Beugung. Sie führt auch dazu, daß die Patellagleitbahn des Implantates innenrotiert, d.h. medialisiert positioniert wird (Abb.7). Die resultierende Vergrößerung des Implantat-Q-Winkels birgt die Gefahr einer Patella(sub)luxation.
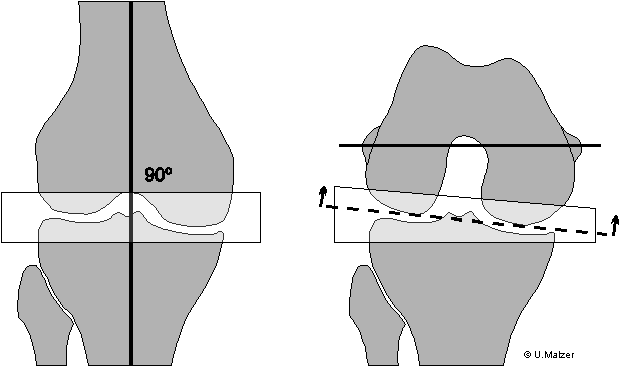 |
| Abb.5: ‘Klassische Resektion’ ohne Rotationskorrektur: Der distal-femorale sowie der tibiale Schnitt liegen senkrecht auf der mechanischen Beinachse; der dorsale Femurschnitt liegt parallel zur dorsalen Condylenlinie. In Beugestellung resultiert ein trapezförmiger Resektionsspalt. |
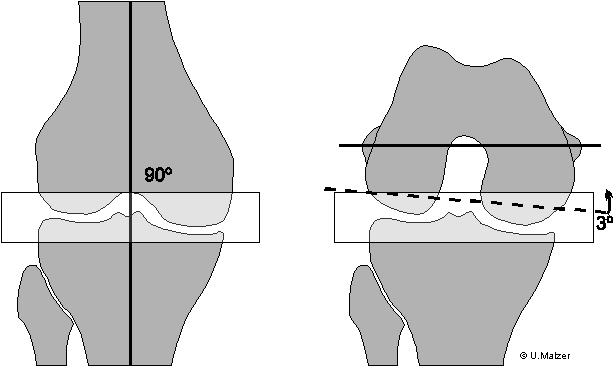 |
| Abb.6: ‘Klassische Resektion’ mit Außenrotationskorrektur: Durch die Korrektur wird ein paralleler Resektionsspalt in Beugung erzeugt. |
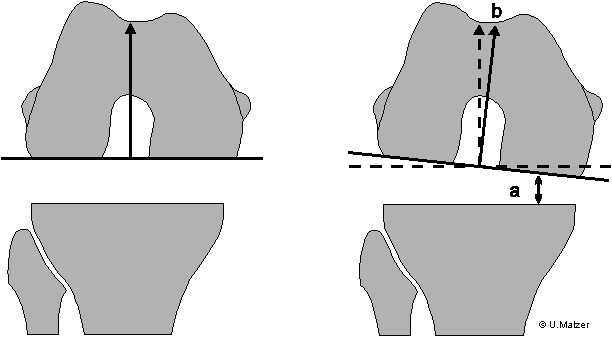 |
| Abb.7: Links : Klassische Resektion mit Rotationskorrektur. Paralleler Resektionsspalt, die trochlea projiziert sich zentral über dem Intercondylicum. Rechts : Klassische Resektion ohne Rotationskorrektur. Trapezförmiger Gelenkspalt (a), Medialisierung der Trochlealinie (b). |
Bei einer ausgeprägten Varus- oder Valgusgonarthrose finden sich immer knöcherne Defizite. Diese sind erfahrungsgemäß beim Varusknie haptsächlich am medialen Tibiaplateau, bei der Valgusgonarthrose am lateralen Femurcondylus lokalisiert (Abb.8).
Für die posteriore femorale Resektion ergibt sich hieraus, daß die dorsale Condylentangente nicht immer als zuverlässige Referenz für eine korrekte Rotationsausrichtung herangezogen werden kann.
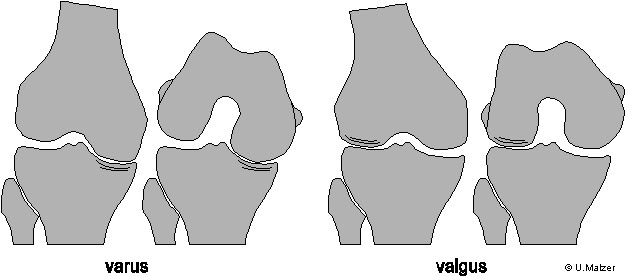 |
| Abb.8: Knöcherne Defizite beim Varus- und Valgusknie. |
Aus diesem Grund wurde vorgeschlagen, als Rotationsreferenz andere anatomische Landmarken zu verwenden. Als besonders zuverlässig haben sich hier zwei Hilfslinien bewährt (Abb.9):
1. Die transepicondyläre Linie oder ‘Insall-Linie’ (4).Sie verbindet den medialen mit dem lateralen Epicondylus. Der dorsale Sägeschnitt wird parallel zu der entsprechenden Linie gelegt. Diese Resektion entspricht im Normalfall der Resektion mit 3-Grad Außenrotationskorrektur.
Aufgrund der konstanten Lage der Epicondylen ist die dorsale femorale Resektion parallel zur Insall-Linie jedoch unabhängig von knöchernen Defiziten am Femur und stellt somit auch in Fällen stärkerer Achsabweichung eine zuverlässige Referenz dar (Abb.10).
Die Insall-Linie hat einen kleinen Nachteil: sie ist nicht immer leicht zu identifizieren, weil die Epicondylen unter den Collateralbandursprüngen manchmal schwer zu tasten sind. Darüberhinaus ist der mediale Epicondylus sichel- bzw halbmondförmig ausgelegt und man muß sein Zentrum auffinden.
2. Als Alternative bzw. Ergänzung wurde deshalb vorgeschlagen, die sogenannte a/p - Achse oder ‘Whiteside-Linie’ zu bestimmen. Es handelt sich um die Verbindungslinie vom tiefsten Punkt der Trochlea zum höchsten Punkt des Intercondylicums (Abb.9).
Genauere Nachmessungen und statistische Auswertungen an gesunden und arthrotischen Femora haben ergeben, daß die a/p - Achse sehr genau zur Epicondylenachse korreliert. Sie steht praktisch immer senkrecht auf der Epicondylenachse.
Da die a/p - Achse leichter zu bestimmen ist, ist ihre Fehlerbreite etwas geringer, als bei der Insall-Linie (3).
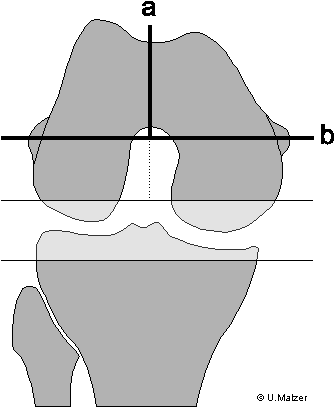 |
| Abb.9: Epicondylenlinie (a) und a/p-Achse (b). |
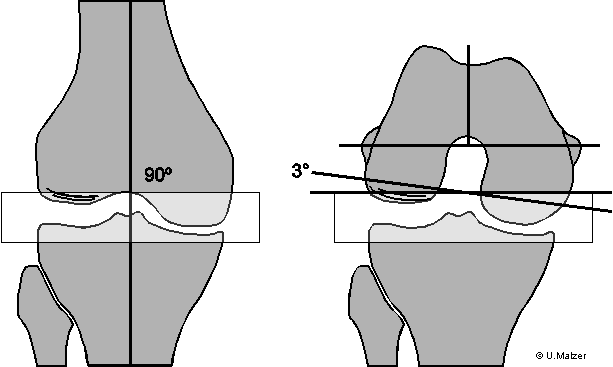 |
| Abb.10: Korrekte Resektion beim Valgusknie. Eine 3-Grad-Korrektur würde nicht ausreichen, um einen parallelen Beugespalt zu erzeugen. |
Bei der Ausrichtung der tibialen Komponente sind vor allem zwei Faktoren von Bedeutung:
Die posteriore Neigung ist mitverantlich für die Weite des Gelenkspaltes in Beugung. Ist sie zu gering, so entsteht aufgrund der relativen Enge ein Beugedefizit. Ist die Neigung zu stark, so entsteht eine Instabilität in Beugung, welche zu einem verstärkten ‘roll back’ der femoralen Komponente führt.
Hierdurch kann es zu einer Überlastung des posterioren Inlays mit entsprechend vermehrtem Verschleiß kommen (11). Aus diesem Grunde wurde empfohlen, einen Neigungswinkel zu wählen, welcher etwas geringer ist, als der anatomische Winkel von etwa 7 Grad (12). Es scheint somit sinnvoll, einen posterioren Neigungswinkel von etwa 3-5 Grad nicht zu überschreiten.
Die Bestimmung der posterioren Neigung ist etwas genauer, wenn man sich nicht an der Gelenkfläche, sondern an der Tibiavorderkante orientiert, weil man hier eine längere Vergleichsstrecke hat.
Rein rechnerisch erzeugt eine Kippung der Meßlinie an der Gelenkfläche um 1 Millimeter einen Winkel von etwa 1,2 Grad, während über die Länge des Unterschenkels gemessen eine Veränderung um 1 Zentimeter lediglich eine Winkeländerung von ca. 1,5 Grad zur Folge hat (Abb.11).
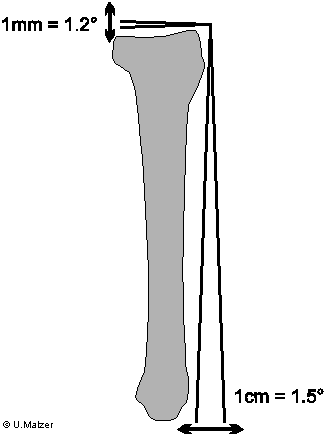 |
| Abb.11: Für die Beurteilung der posterioren Neigung des Tibiaplateaus liefert die Tibiavorderkante eine sicherere Referenz. |
Für einen zentrierten Lauf der Patella ist natürlich auch die Rotationsausrichtung der tibiale Komponente verantwortlich. Hierbei muß auf jeden Fall eine Innenrotation der Komponente vermieden werden, da diese zu einer Außenrotation der Tuberositas mit Vergrößerung des Q-Winkels und Lateralisation der Patella führt (Abb.12).
Auch hier gibt es einige Landmarken zur Orientierung (Abb.13). Am zuverlässigsten ist die Orientierung am medialen Rand oder dem medialen Drittelpunkt der Tuberositas tibiae (8). Sie ist leicht aufzufinden und steht in direkter Korrelation zum Lauf der Patella.
Die häufig gewählte Orientierung an der Sprunggelenksmitte oder dem 3. Metatarsaleknochen birgt die Gefahr eines Innenrotationsfehlers: Gerade bei Verwendung eines Fußhalters wird der Fuß nach ventral festgehalten, während bei Luxation der Patella nach außen die Patellarsehne den Tibiakopf nach außen rotiert. Es kann somit zu einem Innenrotationsfehler bei der Ausrichtung der tibialen Komponente kommen (Abb.14).
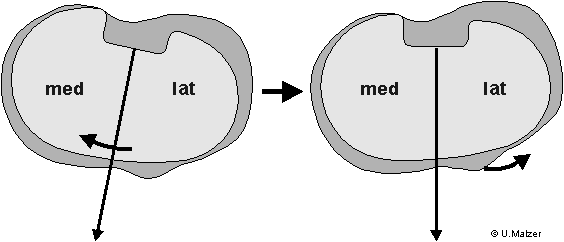 |
| Abb.12: Eine Innenrotation der tibialen Komponente (links) erzeut eine Außenrotierung der tuberositas tibiae (rechts). |
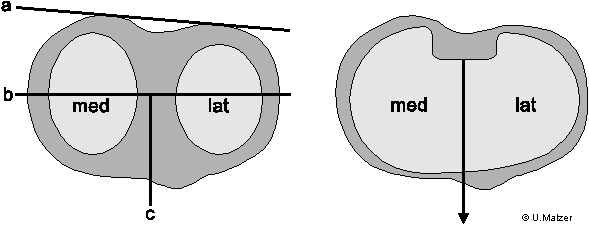 |
| Abb.13: Referenzlinien für die Rotationsausrichtung der tibialen Komponente. a : posteriore Condylenlinie; b : transcondyläre Linie; c : Tuberositaslinie. Rechts : Die Orientierung an der Tuberositaslinie ergibt die zuverlässigste Ausrichtung der tibialen Komponente. |
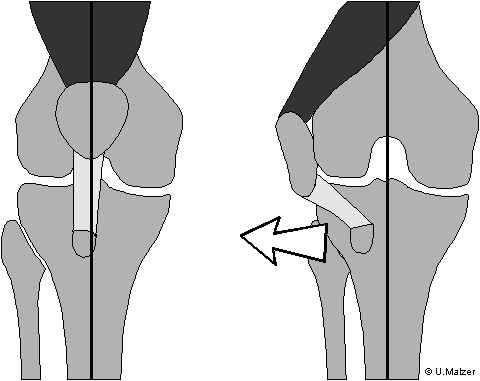 |
| Abb.14: Die intraoperative Luxation der Patella nach lateral erzeugt eine Außenrotation des Tibiakopfes. |
Die Führung der Patella stellt eines der Hauptprobleme der Knieendoprothetik dar.
Etwa 30-40 Prozent aller Komplikationen betreffen das Patellofemoralgelenk. Aus dem vorher gesagten ergibt sich, daß eine korrekte Rotationsausrichtung der femoralen und tibialen Komponente die Grundvoraussetzung für einen zentrierten Lauf der Patella darstellen.
Beim Ersatz der Patella ist darüber hinaus zu beachten, daß das Implantat mit einem leichten medialen Versatz implantiert wird. Dies entspricht der Position des natürlichen Patellafirstes (14). Bei kleinen Patellen empfiehlt sich die Wahl kleiner Implantatgrößen, um den entsprechenden Versatz realisieren zu können.
Eine zusätzliche Verbesserung der Zentrierung kann im Einzelfall erreicht werden, indem die femorale Komponente wenige Millimeter nach lateral versetzt wird (Abb.15).
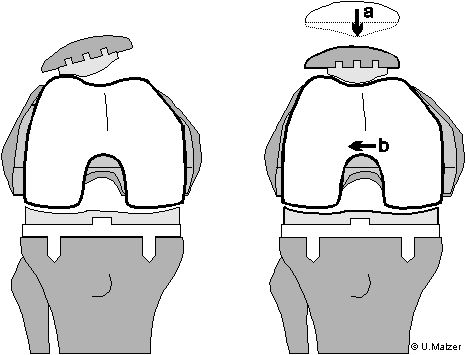 |
| Abb.15: Bessere Zentrierung der Patella durch Positionierung des Implantates mit anatomischem Medialversatz (a) sowie durch leichte Lateralisierung der femoralen Komponente (b). |
Das Design künstlicher Kniegelenke hat sich in den vergangenen Jahren ständig verbessert und moderne Instrumentare erlauben eine hohe Präzision bei der Implantation. Man darf sich indes nicht immer auf das Instrumentar verlassen.
Gerade bei stärkeren Achsfehlern, knöchernen Defekten und ligamentären Imbalancen ist eine korrekte Komponentenausrichtung mit Orientierung an den anatomischen Landmarken die Grundvoraussetzung für den Erfolg der Operation.
Erst nach Durchführung der adäquaten Sägeschnitte sollte überprüft werden, ob noch ligamentäre Imbalancen bestehen, die die Durchführung der entsprechenden Korrekturen (Bandreleases etc.) erforderlich machen.
In unserem eigenen Patientengut konnten wir beobachten, daß bei Beachtung aller oben geschilderter Details deutlich bessere klinische Resultate zu erwarten sind. Die Notwendigkeit, laterale Kapselreleases oder gar Tuberositasversetzungen durchzuführen, ist drastisch gesunken. Auch die postoperative Mobilisation der Patienten wird erleichtert, wenn das Implantat korrekt positioniert und ligamentär adäquat balanciert ist.
1. Aglietti, P., Insall, J.N., Cerulli, G.: Patellar pain and incongruence. I:Mesurements of incongruence. Clin. Orthop. 176(1983) 217-224
2. Anouchi, Y.S., Whiteside, L.A., Kaiser, A.D., Milliano, M.T.: The effects of axial rotational alignment of the femoral component on knee stability and patellar tracking in total knee arthroplasty demonstrated on autopsy specimens. Clin.Orthop. 287 (1993) 170-177
3. Arima, J., Whiteside, L.A., McCarthy, D.S., White, S. E.: Femoral rotational alignment, based on the anteroposterior axis, in total knee arthroplasty in a valgus knee. J. Bone Joint Surg. (A) 77,9 (1995) 1331-1334
4. Berger, R.A., Rubash, H.E., Seel, M.J., Thompson, W.H., Crossett, L.S.: Determining the rotational alignment of the femoral component in total knee arthroplasty using the epicondylar axis. Clin. Orthop. 286 (1993) 40-47
5. Hsu, R.W., Himeno, S., Coventry M.B., Chao, E.Y.: Normal axial alignment of the lower extremity and load-bearing distribution at the knee. Clin. Orthop. 255 (1990) 215-27
6. Krackow, K.A. : Approach to planning lower extremity alignment for the total knee arthroplasty and osteotomy about the knee. Adv. Orthop. Surg. (1983) 69- 88
7. Krackow, K.A.: The technique of total knee arthroplasty. Mosby, St.Louis, 1990
8. Lotke, P.A.: Knee Arthroplasty. 6:Standard principles and techniques. In: Thompson, R.C. (ed.):Master techniques in orthopaedic surgery. Raven Press New York 1995
9. Moreland, J.R., Basset, L.W., Hanker, G.J.: Radiographic analysis of the axial alignment of the lower extremity. J. Bone Joint Surg. (A) 69,5 (1987) 745-749
10. Ranawat, C.S., Rodriguez, J.A.: Malalignment and malrotation in total knee arthroplasty. In: Insall, J.N., Scott, W.N., Scuderi, G.R. : Corrent concepts in primary and revision total knee arthroplasty. Lippincott-Raven, Philadelphia 1996
11. Wasielewski, R.C., Galante, J.O., Leightly, R.M., Natarjan, R.N., Rosenberg, A.G.: Wear patterns on retrieved polyethylene tibial inserts and their relationship to technical considerations during total knee arthroplasty. Clin. Orthop. 299 (1994) 31-43
12. Whiteside, L.A., Amador, D.D.: The effect of posterior tibial slope on knee stability after Ortholoc total knee arthroplasty. J. Arthroplasty 3 (1988) Suppl:51- 57
13. Whiteside, L.A., Arima, J.: The anteroposterior axis for femoral rotational alignment in valgus total knee arthroplasty. Clin.Orthop. 321 (1995) 168-172
14. Yoshii, I., Whiteside, L.A., Anouchi, Y.S.: The effect of patellar button placement and femoral component design on patellar tracking in total knee arthroplasty. Clin. Orthop. 275 (1992) 211-219