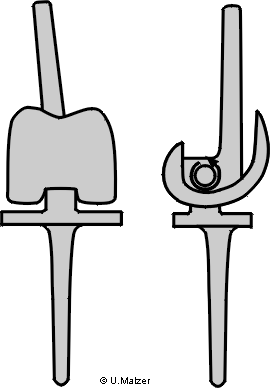
veröffentlicht in: A.B. Imhoff (Hrsg.): Fortbildung Orthopädie, Band 3, Kapitel 17, Steinkopff Darmstadt
Die Aufgabe einer Knieendoprothese besteht im
Entsprechend der Quantität und Qualität, in welcher die natürliche Gelenkfunktion
ersetzt wird, können Knieendoprothesen in unterschiedliche Kategorien eingeteilt
werden. Diese Einteilung erweist sich als sinnvoll, weil sich hierdurch nicht
nur das Indikations- und Anwendungsspektrum, sondern auch die spezifischen Vor-
und Nachteile der einzelnen Systeme unterscheiden lassen.
Der geordnete Bewegungsablauf eines natürlichen Kniegelenkes wird im wesentlichen
durch die Geometrie der knöchernen Gelenkpartner, die Führung des Kapsel-Band-Apparates
und der Menisken sowie die Einwirkung muskulärer Kräfte beeinflußt.
Ein erkranktes Gelenk hat eine oder mehrere dieser Funktionen verloren, und
es ist die Aufgabe des endoprothetischen Ersatzes, diesen Funktionsverlust in
möglichst adäquater Weise zu ersetzen.
Verschiedene Endoprothesensysteme müssen deshalb danach unterschieden werden,
in welchem Ausmaß sie die Bewegungskomponenten Valgus/Varusangulation, antero-posteriore
Translation, Rotation, Rollen und Gleiten innerhalb des normalen Bewegungsumfanges
ermöglichen und in welchem Umfang sie eine verlorene Stabilität des Kollateral-
und Kreuzbandapparates ersetzen [15,25].
Eines der wichtigen Probleme der Knieendoprothetik stellt der sogenannte 'kinematische Konflikt' dar. Hierbei handelt es sich um den Widerspruch zweier Prinzipien:
Da das Kniegelenk kein Kugelgelenk ist, führt eine Erhöhung der Kongruenz der Gelenkpartner zu einer Verminderung der Bewegungsfreiheit. Jedes Design einer Knieendoprothese muß somit auch als Kompromiß verstanden werden, welcher diesen kinematischen Konflikt auf eigene Weise zu lösen versucht.
In Anlehnung an die gängige Literatur [13,15,22] können je nach Art und Ausmaß
der mechanischen Kopplung zwischen tibialer und femoraler Komponente die nachgenannten
Designs unterschieden und klassifiziert werden (vgl. Tabelle 1).
Bei der Beschreibung der konstruktiven Auslegung werden der Übersichtlichkeit
halber nur die für den jeweiligen Typ gängigsten Lösungen erwähnt. Es werden
die angloamerikanischen Termini mitgenannt, da sie auch in unserem Sprachraum
Verwendung finden.
| Hauptgruppe | Untergruppe |
Rotation
|
a/p-Translation
|
valgus/varus
|
| LINKED | Rigid Hinge |
-
|
-
|
-
|
| Rotating Hinge |
+
|
-
|
-
|
|
| NON-LINKED | Constrained Condylar |
+
|
-
|
(-)
|
| Posterior Stabilized |
+
|
(-)
|
+
|
|
| Conforming Condylar |
(-)
|
-
|
+
|
|
| PCL Retaining |
+
|
+
|
+
|
|
| Unicondylar |
+
|
+
|
+
|
|
| Tabelle 1: Einteilung der heute gängigen Knieendoprothesensysteme. | ||||
Gekoppelte Systeme zeichnen sich durch eine mechanisch feste Verbindung zwischen der femoralen und tibialen Komponente aus. Entsprechend der Art der Verbindung wird zwischen Starrachsgelenken und Rotationsknien weiter unterteilt.
Starrachsgelenke ('Rigid Hinge') erlauben lediglich eine Flexions-/Extensionsbewegung, d.h. es findet nur eine Rotation um die Transversalachse statt. Hierbei werden die axialen Belastungskräfte in der Regel über das Scharnier von der femoralen auf die tibiale Komponente übertragen. Während die sehr frühen Designs über rein metallische Scharniere verfügten, wurden spätere Konstruktionen mit Polyäthylenlaufbuchsen versehen.
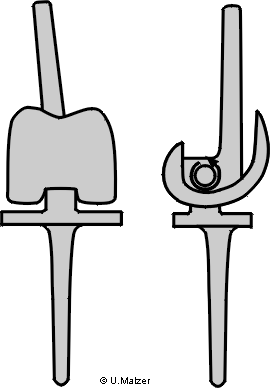 |
| Abb. 1: Rigid Hinge |
Beim Rotationsknie ('Rotating Hinge') besteht zusätzlich eine Bewegungsmöglichkeit
um die Longitudinalachse. Diese ist typischerweise auf einen Winkel von etwa
15 Grad in beide Richtungen limitiert. Durch verschiedene konstruktive Auslegungen
wird die Rotation aber in Streckstellung verriegelt, so daß sich hier eine Rotationsstabilität
ergibt.
Die axialen Belastungskräfte werden zumeist durch ein Polyäthyleninlay übertragen.
Im Gegensatz zu Starrachsgelenken besitzen die meisten Rotationskniegelenke
auch über die Möglichkeit zur Längsdistraktion, was den 'constraint' (Kopplungsgrad)
bei extremer Beugung zusätzlich reduziert.
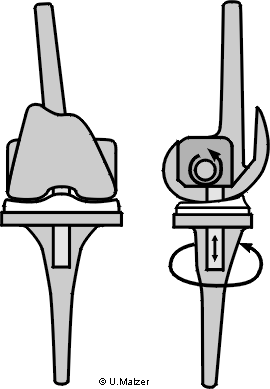 |
| Abb. 2: Rotating Hinge |
Bei ungekoppelten Systemen findet sich keine feste Verbindung zwischen den
Komponenten, d.h. eine Trennung von tibialer und femoraler Komponente ist ohne
Disassemblierung möglich. Trotz fehlender fester Verbindung können ungekoppelte
Systeme unterschiedliche Freiheitsgrade haben.
Hieraus ergibt sich die weitere Unterteilung:
Bei diesen Gelenken findet sich in der Regel im Artikulationszentrum der tibialen Komponente ein längerer Zapfen oder Kamm, welcher in einen Kasten der femoralen Komponente hineinragt. Durch den Kontakt der Komponenten im Kasten wird eine valgus/varus - Stabilität gewährleistet und die hintere Schubladenverschieblichkeit der Tibia limitiert. Je nach Auslegung des Zapfens ist zusätzlich die Rotation des Femurs begrenzt.
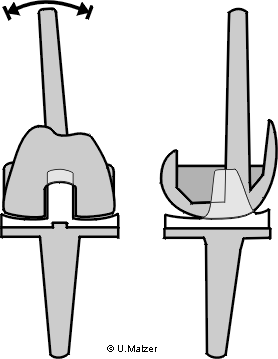 |
| Abb. 3: Posterior Stabilized Constrained |
Bei diesem Design ist der Zapfen kürzer ausgelegt, so daß sich keine wesentliche valgus/varus - Stabilisierung ergibt. Es liegt also lediglich eine Begrenzung der hinteren Schubladenbeweglichkeit sowie eine Begrenzung der mediolateralen Translation vor.
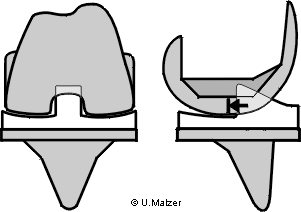 |
| Abb. 4: Posterior Stabilized |
Bei diesen Systemen wird die Stabilität durch die Konformität der tibialen und femoralen Komponente in der Sagittal- und Frontalebene erzeugt. In Kombination mit der ligamentären und muskulären Verspannung des Gelenkes wird eine antero-posteriore Verschieblichkeit der Tibia sowie ein roll-back der femoralen Komponente verhindert. Das Ausmaß der Konformität limitiert darüber hinaus das Rotationsverhalten der Prothese.
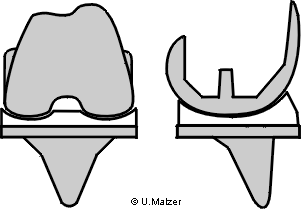 |
| Abb. 5: Conforming Condylar |
Dieses Design wird heute üblicherweise für die Primärimplantation bei bandstabilen Gelenken verwendet. Hierzu sollte das hintere Kreuzband (PCL) möglichst erhalten sein, um die hintere Schubladenbeweglichkeit zu sichern.
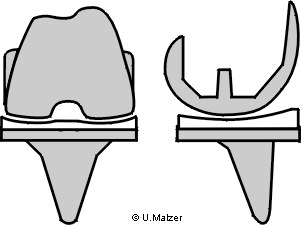 |
| Abb. 6: PCL Retaining |
Die monocondylären Schlittenprothesen werden bei der unikompartimentellen medialen oder (seltener) lateralen Gonarthrose verwendet. Die PE - Lauffläche ist in den meisten Fällen flach ausgelegt.
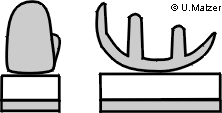 |
| Abb. 7: Unicondylar |
Neben der o.g. funktionellen Klassifikation sei an dieser Stelle noch eine weitere häufig diskutierte Unterscheidung erwähnt, bei der es sich jedoch nur um eine Designdifferenzierung handelt:
Bei 'fixed bearing' - Implantaten ist das Polyäthyleninlay fest auf der tibialen Trägerplatte verankert. Die tibiofemorale Gelenkbewegung findet also ausschließlich im Interface zwischen femoraler Komponente und PE-Inlay statt.
Im Gegensatz hierzu finden sich sog. 'mobile bearing' - Designs, bei denen das Inlay beweglich auf der (polierten) tibialen Trägerplatte montiert ist. Durch dieses Konstruktionsdetail soll versucht werden, den PE-Abrieb durch eine größere Kongruenz zwischen femoraler Komponente und Inlay zu verbessern. Als weitere Untergruppen lassen sich die sog. 'gliding menisci' - Implantate von den 'rotating platforms' unterscheiden.
Je nach konstruktiver Auslegung lassen sich die 'mobile bearing' - Gelenke vom funktionellen Standpunkt und vom Indikationsspektrum in die Gruppen 'PCL - Retaining' oder 'Posterior stabilized' einordnen.
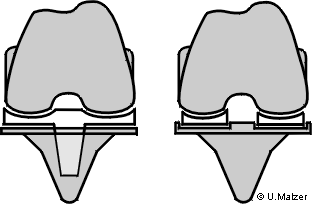 |
| Abb. 8: Mobile bearings; links: rotating platform, rechts: gliding menisci |
Die klinische Erfahrung hat gezeigt, daß für den Erfolg der Kniegelenksarthroplastik
die Auswahl des passenden Prothesendesigns von entscheidender Bedeutung ist.
Ganz allgemein kann formuliert werden, daß entsprechend den Stabilitätsverhältnissen
des zu operierenden Gelenkes 'sowenig Constraint wie möglich, aber auch soviel
Constraint wie nötig' zur Anwendung kommen muß.
Man wird also bei instabilen Gelenken, hohem Knochensubstanzverlust und großer
Achsabweichung eher zu Prothesen mit höherem Kopplungsgrad greifen.
'Rigid Hinges' werden heutzutage nur noch selten eingesetzt. Ihre Benutzung ist allenfalls noch bei völlig destruierten und instabilen Gelenken mit insuffizientem Streckapparat gerechtfertigt, bei denen als Alternative eigentlich nur noch die Arthrodese in Betracht kommt [13,15,25]. Außerdem werden Implantate dieser Gruppe häufig noch als Tumorprothesen eingesetzt.Aufgrund der starren Kopplung wurden vermehrt periprothetische Frakturen und Auslockerungen beobachtet [4,14]. Auch das Infektionsrisiko ist im Vergleich zu anderen Designs relativ erhöht.
Als typische Indikationen für 'Rotating Hinges' und 'Posterior Stabilized
Constrained'- Systeme gelten Revisionsfälle und Gelenke mit Insuffizienz
des Seitenbandapparates, extremer Valgus- und Varusfehlstellung bei relativ
intaktem Streckapparat [13,15,25]. Diese Designs zeigen bessere klinische Resultate
als die älteren 'Rigid Hinge' - Systeme.
Da auch die Implantate dieser Gruppen relativ ausgedehnte knöcherne Resektionen
erfordern und sie im Falle einer Infektion oder Auslockerung schwieriger zu
wechseln sind, sollte die Indikation zu ihrem Einsatz jedoch ebenfalls mit Bedacht
gestellt werden.
'Conforming Condylar' und 'Posterior stabilized' - Systeme haben
einen geringen Constraint und werden deshalb als Primärimplantate verwendet.
Sie werden auch als 'PCL sacrificing devices' bezeichnet. Bei Resektion
oder Instabilität des hinteren Kreuzbandes sollen sie eine posteriore Subluxation
des Tibiakopfes mit konsekutiver Überbelastung des PE-Inlays verhindern.
Während für die 'posterior stabilized' - Gelenke gute und sehr gute Langzeitergebnisse
vorliegen, sind 'conforming condylar' - Designs in ihrer ursprünglichen Form
verlassen worden, weil die fehlende Rotationsmöglichkeit eine sehr exakte Implantatpositionierung
erforderlich machte.
Eine gewisse Renaissance erfuhr diese Gruppe durch die Einführung sogenannter
'ultrakongruenter' Inlays, welche in Streckung des Gelenkes eine höhere Kongruenz
haben, in Beugung aber eine größere Rotation erlauben.
'PCL Retaining devices' gelten als Standard-Primärimplantate bei erhaltenem und intakten Bandapparat. Die knöchernen Resektionen sind relativ sparsam, in der Regel ist jedoch eine Resektion des vorderen Kreuzbandes erforderlich. Wegen des relativ geringen Kopplungsgrades ist insbesondere in dieser Gruppe die Verwendung zementfreier Implantate möglich.
Der Einsatz unicondylärer Schlittenprothesen wird noch immer kontrovers
diskutiert. Neben Berichten über gute und sehr gute Langzeitergebnisse wurden
auch häufiger auftretende Implantatlockerungen beschrieben.
Für den erfolgreichen Einsatz von Schlittenprothesen scheint die korrekte Indikationsstellung
und eine exakte Implantationstechnik die entscheidende Voraussetzung zu sein.
Neben der isolierten medialen oder (seltener) lateralen Gonarthrose sollte ein
völlig intakter Bandapparat sowie eine weitgehend erhaltene gerade Beinachse
vorliegen. Für das Zusammenspiel mit der kontralateralen Gelenkfläche erfordern
Schlittenprothesen eine sehr exakte Implantatpositionierung ohne mechanische
Spannungen und ohne Rotationsfehler.
Im Folgenden soll auf einige Besonderheiten der Operationstechnik beim künstlichen Kniegelenksersatz eingegangen werden. Hierbei sollen nicht die speziellen Operationsverfahren (Zugangswege etc.) oder Fragen der speziellen Instrumentierung erläutert werden. Diese sind der einschlägigen Literatur bzw den systemspezifischen OP - Anleitungen zu entnehmen. Das Augenmerk soll vielmehr auf einige anatomische Details sowie die korrekte Positionierung der Implantate gelegt werden, wie sie auch in [17] beschrieben wurde (Dieser Publikation wurden auch die folgenden Abbildungen entnommen).
Die natürliche Kniegelenkslinie steht nicht exakt in der Horizontalebene. Sie weist vielmehr eine Varusneigung von etwa 3 Grad auf. Anatomisch ausgedrückt, entspricht dies einer Prominenz des medialen Femurcondylus nach distal und dorsal sowie einer entsprechenden Neigung des Tibiaplateaus nach medial (Abb.9) [11,18].
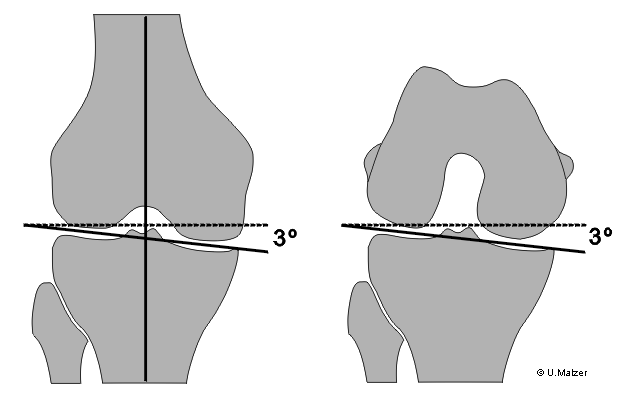 |
| Abb.9: Verlauf der Kniegelenkslinie |
In der Seitansicht ist das Tibiaplateau normalerweise um etwa 7 Grad nach posterior geneigt. Hierbei finden sich aber relativ starke individuelle Schwankungen.
Bezogen auf die Lage der natürlichen Kniegelenksebene lassen sich grundsätzlich zwei Verfahren für das Anlegen der tibialen und femoralen Resektionen unterscheiden [12]:
Bei der 'anatomischen' Resektion werden die Schnitte parallel zur Kniegelenksebene durchgeführt. Hierdurch werden an Tibia und Femur medial und lateral gleich dicke knöcherne Scheiben entfernt. Die selbe Resektionshöhe wird auch am posterioren Femur gewählt, so dass sich sowohl in Beugung als auch in Streckung ein paralleler Resektionsspalt ergibt (Abb.10).
Im Normalfall ist zu erwarten, dass aus der identischen Höhe von 'flexion gap' (Beugespalt) und 'extension gap' (Streckspalt) ein gut balanciertes künstliches Gelenk resultiert.
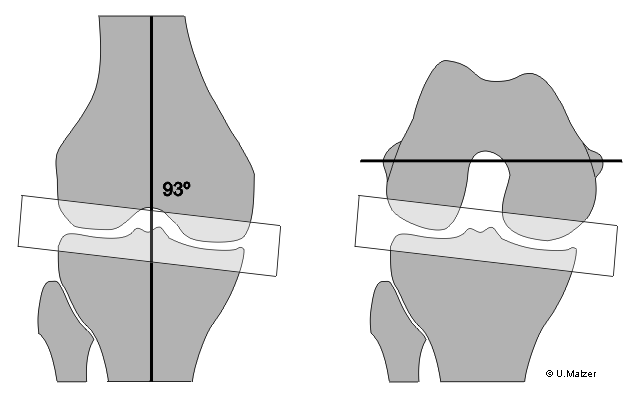 |
| Abb.10: Anatomische Resektion |
Die meisten modernen Instrumentare sind für die die sogenannte 'klassische'
Resektion (auch: 'Standardresektion') ausgelegt (Abb.11,12).
Bei diesem Verfahren werden die Sägeschnitte senkrecht zur mechanischen Beinachse,
also in die Horizontalebene gelegt. Hieraus resultieren unterschiedliche Resektionshöhen
medial und lateral an Femur und Tibia. In Streckung des Gelenkes gleichen sich
die unterschiedlichen Resektionshöhen aus, sodass ein paralleles 'extension
gap' resultiert.
Bezüglich des 'flexion gap' ergibt sich hieraus eine wichtige Konsequenz:
Wird die posteriore femorale Resektion parallel zur posterioren Condylentangente
durchgeführt, so resultiert hieraus ein trapezförmiger Beugespalt, welcher medial
relativ zu eng ist. Dieser Umstand erklärt sich durch die mediolaterale Asymmetrie
der tibialen Resektion (Abb.11).
Diese relative Enge des medialen Beugespaltes kann die Ursache für einen vorzeitigen
Verschleiss des posteromedialen PE -Inlays sein.
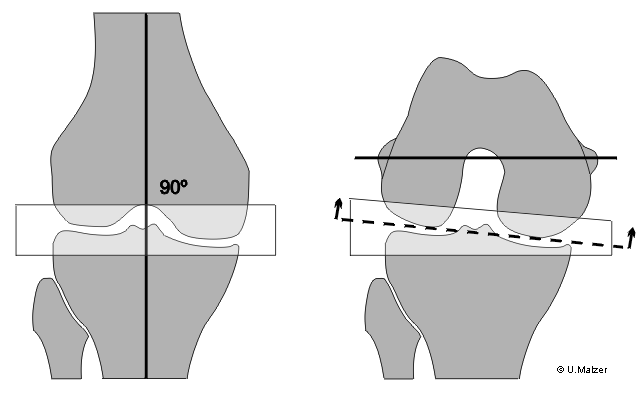 |
| Abb.11: Klassische Resektion ohne Rotationskorrektur |
Aus diesem Grunde ist eine Korrektur der posterioren femoralen Resektion erforderlich. Hierzu muss der entsprechende Sägeschnitt mit einer Außenrotation von 3 Grad bezogen auf die dorsale Condylentangente durchgeführt werden (Abb.12).
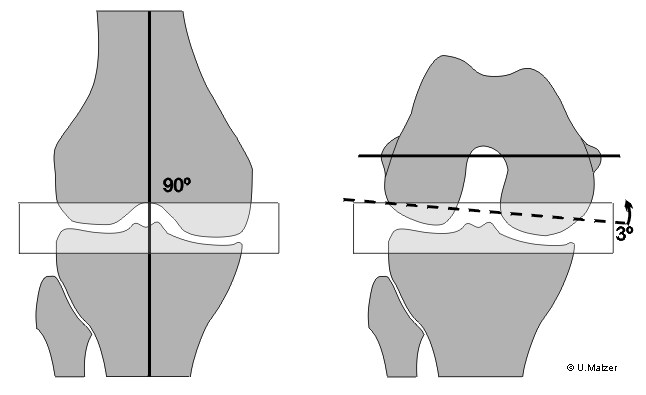 |
| Abb.12: Klassische Resektion mit Rotationskorrektur |
Eine fehlerhafte dorsale Femurresektion mit zu wenig Außenrotationskorrektur erzeugt nicht nur einen relativ engen medialen Gelenkspalt in Beugung. Sie führt auch dazu, daß die Patellagleitbahn des Implantates innenrotiert, d.h. medialisiert positioniert wird. Die resultierende Vergrößerung des Implantat-Q-Winkels birgt die Gefahr einer Patella(sub)luxation.
Die oben beschriebenen Verfahren zur Rotationsausrichtung der femoralen Komponente
sind nur in Fällen mit relativ geringem knöchernen Substanzverlust gültig.
Bei ausgeprägten knöchernen Formveränderungen ist die posteriore Condylentangente
keine zuverlässige Referenz für die Rotationsausrichtung der femoralen Komponente.
Insbesondere bei der schweren Valgusgonarthrose findet sich aufgrund der lateralseitigen
Abnutzung eine innenrotierte Lage dieser Linie.
Zur Kontrolle der korrekten Rotation sollten daher konstantere anatomische Landmarken
herangezogen werden (Abb.13):
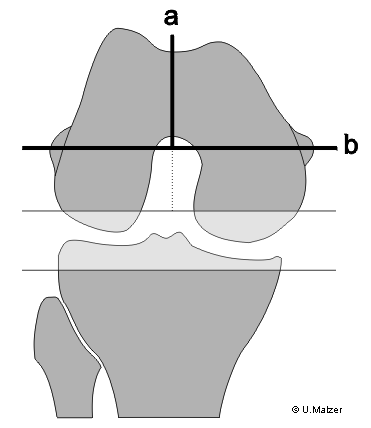 |
| Abb.13: Epicondylenlinie (a) und a/p - Achse (b) |
Epicondylenlinie und a/p - Achse liegen sowohl beim normalen als auch beim arthrotisch veränderten Femur praktisch immer senkrecht zueinander, so dass es sich hier um eine äußerst zuverlässige anatomische Referenz handelt [2].
Die posteriore Neigung der tibialen Komponente sollte sich an der natürlichen Anatomie orientieren. Hierdurch läßt sich in der Regel eine adäquate Weite des Gelenkspaltes in Beugung erreichen. Ist die Komponente zu stark geneigt, so besteht jedoch eine Gefährdung des posterioren Polyäthyleninlays durch ein exzessives 'roll back' der femoralen Komponente in Kombination mit einer Flexionsinstabilität [26]. Aus diesem Grund scheint ein leichtes Unterschreiten des physiologischen Wertes sinnvoll und eine Neigung von ca. 3-5 Grad angemessen [27]
Die Rotationsausrichtung der tibialen Komponente ist mitverantwortlich für einen zentrierten Lauf der Patella. Es ist zu beachten, daß eine Innenrotation der Komponente zu einer Außenrotation der Tuberositas Tibiae führt. Die resultierende Vergrößerung des Implantat - Q-Winkels kann zu einer Subluxationstendenz der Patella beitragen. Für die korrekte Rotationsausrichtung der Komponente empfiehlt sich deshalb eine Orientierung am medialen Rand oder dem medialen Drittelpunkt der Tuberositas tibiae [16] (Abb.14).
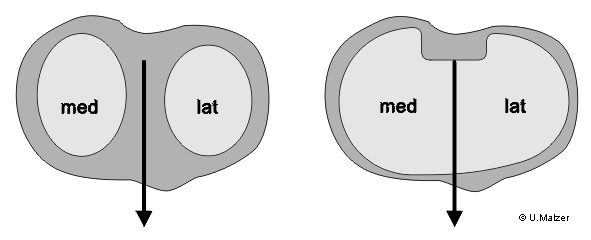 |
| Abb.14: Rotationsausrichtung der tibialen Komponente |
Das Erreichen einer zentrierten Patellaführung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen
für einen erfolgreichen Kniegelenksersatz. Die meisten Fälle einer Subluxationstendenz
der Patella sind auf eine Implantation der femoralen und/oder tibialen Komponente
in Innenrotationsfehlstellung zurückzuführen.
Wenn ein endoprothetischer Ersatz der Patella duchgeführt wird, so ist darauf
zu achten, daß die natürliche Asymmetrie der Patella berücksichtigt und das
Implantat mit einem entsprechenden leichten Versatz nach medial eingesetzt wird.
Im Einzelfall kann die Zentrierung darüber hinaus durch einen geringen Versatz
der femoralen Komponente nach lateral verbessert werden (Abb.15).
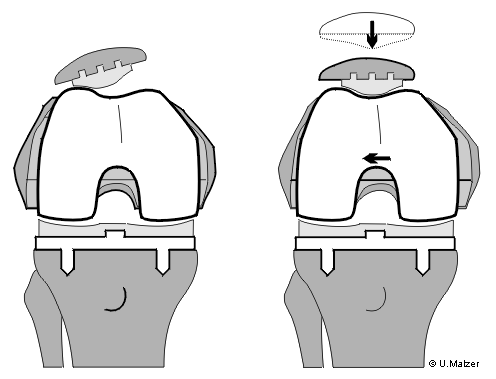 |
| Abb.15: Verbesserung der Patellaführung |
Der künstliche Kniegelenkersatz stellt eine Herausforderung an den operativen Orthopäden dar. Der Erfolg des Verfahrens ist dabei von vielen Faktoren abhängig.
Die Wahl des korrekten Implantattyps muß sich an Form und Ausmaß der vorgefundenen pathologischen Veränderungen orientieren. Nur hierdurch ist ein günstiges Zusammenspiel zwischen künstlichem und natürlichen Gelenk gewährleistet.
Eine anspruchsvolle operative Technik setzt eine genaue Kenntnis der Anatomie des gesunden und arthrotisch veränderten Gelenkes voraus. Die Abhängigkeit verschiedener Optionen der Komponentenausrichtung sollte ebenso bekannt sein wie die verschiedenen Möglichkeiten zur Durchführung von Weichteilkorrekturen.
Oft stellt sich das Problem, dass die Restauration einer geraden Beinachse mit der Erreichung einer ligamentären Balance konkurriert. In diesen Fällen muß entschieden werden, ob operative Möglichkeiten zu Beseitigung des Problems bestehen, oder ob auf ein Implantat mit höherem Kopplungsgrad zurückgegriffen werden muß.
Bei aller Präzision moderner Instrumentare sollte nicht vergessen werden, dass die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg der Operation in der Erfahrung und dem Geschick des Operateurs liegt.